Die
emotional
Degeneration des
Verhältnisses
der Schweizer zur Schweiz:
Das
helvetische Stammland (58 v.Chr
-800): In Geringschätzung des eigenen Landes überzeugte Orgetorix die
Helvetier in den Süden an die Wärme zu ziehen. Dort worden Sie 58
v.Chr. in Bibrakte von den Römern besiegt und unterjocht als deren Untertanen
zurückgeschickt, mit dem Zweck, unter römischer Anleitung eine Barriere
gegen weitere Barbareneinfälle zu bilden. So erlebten sie Aufstieg und
Niedergang des Römer Reichs.
Die
Emanzipation (800-1291): Irische
Mönche (Gallus in St. Gallen, Fridolin in Glarus) setzten nach dem
Untergang der Zivilisation neue Kristallisationspunkte (Klöster) für einen
Neuanfang. Dann übernahm Karl der Grosse das Szepter im Heiligen
Reich Deutscher Nationen. Damit waren die Alpenübergänge nicht mehr
Barrieren, sondern wurden strategisch wichtige Durchgangsstrassen. Mit
diesem Trumpf in der Hand entstand 1291 die Eidgenossenschaft.
Die
Anmassung (1291-1515): Dank ihren militärischen
Siegen (1315 in Morgarten gegen die Habsburger, 1460 Sieg über das
Zwischenreich der Burgunder) kam es 1499 zur tatsächlichen Loslösung
vom Deutschen Reich. Bis 1513 waren die 13 "Alten Orte"
zusammen. Man wurde eine militärische Macht und unterwarf sich Untertanengebiete
und kannibalisierte die weitere Umwelt (Saubannerzüge) und das Geld
floss aus dem Söldnerdienst. In der Schlacht von Marignano 1515 war das Mass
voll und die Eidgenossen unterlagen der modernen Militärtechnik
blutig geschlagen.
Einsichtige
Selbstbesinnung (1515-1798): So zog
man sich in die "immerwährende Neutralität" zurück,
Zwingli begann 1518 als Leutepriester in Zürich mit der Reformation
gegen den Sittenzerfall. Nicht zu letzt wegen Niklaus von der
Flüe,
1417
– 1487,
der die
Selbstbesinnung zuerst einmal persönlich auf sich nahm, konnte
der drohenden
Bürgerkriegs zwischen den Eidgenossen, nach ergebnislosen Verhandlungen
um Aufnahme der Städte Freiburg und Solothurn in den Bund an der Tagsatzung
von Stans, im Stanser Verkommnis von 1481, verhindert werden:
Nachdem
die Eidgenossen 1476/77 dreimal massgebend unter Hans
Waldmann
(1435-89) die burgundischen Heere besiegt hatten -
zuletzt bei Nancy, wo Herzog Karl der Kühne sein Leben verlor -, wurde so
manch einer im Land der Eidgenossen übermütig. Aussenpolitisch
gewannen zwar die Schweizer an Ansehen, und so kam es zu einigen Sonderbündnissen
zwischen einzelnen Mitgliedern des Bundes mit Städten im Elsass und in Süddeutschland
- sogenannte «Burgrechte» -, was jedoch die Stabilität im Innern nicht
sonderlich förderte. Es kamen noch zunehmende Unruhen im Innern hinzu: Übermütige,
jugendliche ehemalige Krieger aus den Landorten suchten Städte heim und
randalierten - so etwa 1478 im berühmt-berüchtigten «Saubannerzug».
Die Folge davon war, dass die Stadtorte untereinander Sonderbündnisse
eingingen, um sich vor solchen Übergriffen aus der Innerschweiz zu schützen.
Das Gleichgewicht drohte vollends verloren zu gehen, als die
Stadtorte zwei mit ihnen verbündete Städte, Freiburg und Solothurn in den
Bund der Eidgenossen aufnehmen wollten. Darin sahen die Landorte für sich
selber grosse Nachteile. Die Eidgenossenschaft war in zwei Lager
gespalten und drohte zu zerbrechen. Man stand am Vorabend eines Bürgerkrieges
mit unabsehbaren Folgen, der dann dank der Vermittlung von Bruder Klaus
abgewendet werden konnte, was die Schweiz auch von den Wirren in Europa verschonte:
"So gab Gott
das Glück, wie bös es auch vormittags noch ausgesehen hatte, dass durch
diese Botschaft alles sich zum Besseren wandte und innerhalb einer Stunde
alles ganz und gar abgewogen und eingerenkt wurde." berichtet der
Luzerner Chronist Diepold Schilling.
Auch
später blieb die Schweiz
vom fürchterlichen Dreissigjährigen Krieg verschont und wurde im
westfälischen Frieden von 1648 auch formell aus dem Deutschen Reich entlassen.
Dann setzte die Selbstgefälligkeit, allem voran der "gnädigen
Herren" in Bern ein, was 1798 zum Einmarsch der Franzosen nach der schmählichen
Niederlage in der Schlacht von Grauholz führte.
Formation
zum modernen Staat (1798-1946):
Zuerst unter der Ägide der Franzosen, dann ab 1815 wieder eigenständig,
entstand 1848 die moderne Schweiz als Willensnation. Im Krieg von
1879/71 bewährte sie sich mit der Grenzbesetzung als Solidaritätsgemeinschaft
mit der Aufnahme der Bourbaki-Armee und in den beiden Weltkriegen mit der bewaffneten
Neutralität.
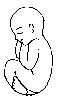 |
Das
Vaterland
(1946-53):
Die
Schweizer waren nach dem 2. Weltkrieg,
dem Zusammenbruch des vorhergehenden emotio-/nationalen Zyklus
weltweit zu
beneiden.
Obwohl ihr Leben mit |
| Weltkrieg
I, Weltwirtschaftskrise und Weltkrieg II in harte Zeiten fiel,
hatten sie es in manchen Dingen doch leichter als andere. Ihr
Glaube an ihr verschont gebliebenes Land war ungebrochen.
Er war, am Ende des damit begonnen neuen Zyklus, im wahrsten Sinne
des Wortes naiv. Die
Schweizer hatten damit aber die äusserste Bedrohung des Landes wie
auch seine Bewahrung vor Unheil wohlbehalten überlebt.
Sie waren getragen vom Bewusstsein,
dass
sie Widerstand geleistet haben
und gekämpft hätten, wenn es denn nötig gewesen wäre, und
diese Gewissheit
gab ihnen Sicherheit. |
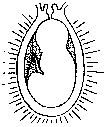 |
Das
Mutterland (1953-60):
In der Schweiz wussten man zwar auch von Quislingen zu
erzählen, von den Fröntlern und den sogenannten Zweihundert, aber
man tat es so, dass klar war: In einem eigensinnigen Land wie der
Schweiz hatten solche
Leute |
| nie
eine reale Chance
gehabt. In
den Schweiz von damals spielte die Landi eine wichtige Rolle,
aber auch das Schauspielhaus Zürich, als Gretler den Wilhelm
Tell spielte und das Publikum aufstand, um gemeinsam «Rufst du,
mein Vaterland» zu singen.
So
sorgte man sich entsprechend der geistigen Landesverteidigung
auch in der Nachkriegszeit nach der braunen gegen die rote Gefahr. |
 |
Das
Hoffnungsland
(1960-67):
1944 geboren wuchs
ich im Vaterland auf, ging im Mutterland zur Schule und
absolvierte 1963 meine Rekrutenschule. Wir waren damals einfach
überzeugt, dass es sich mit |
| der
Entstehung der Eidgenossenschaft in etwa so verhielt, wie Schiller
dies beschrieben hatte. Man war stolz auf diese Geschichte,
nicht aus Überheblichkeit, sondern weil sie sie als eine Art
Verpflichtung empfanden, der Welt ein Vorbild zu sein. Im
Ausland war die Schweiz und ihre Institutionen Hoffnungsträger. Von
dieser Hoffnung mitgetragen macht ich von 1960-65 neben der
Lehre an der AKAD die Matura und begann dann mein
Physikstudium. |
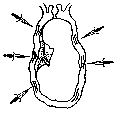 |
Das
Wert- und Mobland
(1967-74):
Auch nach den 68-er Unruhen hat die Mehrheit noch versucht,
den Glauben an die Schweiz weiterzugeben. Ich erlebte den
Globuskrawall als Beobachter und vom |
| Einmarsch in Prag hörte ich auf einem Militärlastwagen
im Sinai - unterwegs als Autostopper. Für uns war diesmal aus
eigener Erfahrung einmal mehr klar, dass
die Schweiz kein Land wie jedes andere ist. Wir sind
die älteste Demokratie der Welt, die Hälfte aller
Volksabstimmungen auf dieser Welt wurde bei uns durchgeführt. Wir
sind ein Hort der Freiheit und eine Zufluchtstätte für alle
Verfolgten,
so im 2. Weltkrieg Krieg für die Polen, 1956 für die Ungarn und
Tibetaner und 1968 für die Tschechen. Wer immer dieses Land
angreife, so lernten wir in der Rekrutenschule an Hand einer
eingebildeten Wagenladung Mongolen, werde dies bitter bereuen. Dies
habe auch Hitler gewusst und einen grossen Bogen um die wehrhafte
Schweiz gemacht. Ein
solches Land zu lieben war leicht, und es
lebte sich gut mit diesem Glauben und den alten Geschichten von
Sempach, der kleinen Stadt und dem mutigen Helden Winkelried und
"Heil dir, Helvetia, hast noch der Söhne, ja, wie sie St.
Jakob sah, freudvoll zum Streit".
Aber
an der 1. Augustfeier der Schweizerbotschaft in Israel war es 1968
störend, dass die Israeli ihre Hymne aus voller Überzeugung, wir
Schweizer, die neue "trittst im Morgenrot daher..."
aber ohne Begeisterung ablesend singen mussten...nach 1968
war eben der Wurm vor Tells Pfeil im Apfel drin!
So
machte ich u.a. deshalb von 1970-73 mein PhD in Australien.
Ich behielt die weltweit hervorragenden Mathematik- und
Physikvorlesungen an der ETH Zürich in guter Erinnerung, wollte
aber mit dem Mobbing
unter den Assistenten und der Politik der Professoren
nichts zu tun haben... |
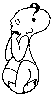 |
Das
Konkurrenzland
(1974-81):
Angeregt vom Vietnamkrieg vermiesten die Intellektuellen
zunehmend nicht nur die Werte dieses Landes sondern diese
selbst. So
musste man selbst
etwas dafür tun, den Stolz dafür zu bewahren. |
| Der
Stolz, in Uniform vom Bahnhof heim zu gehen oder die Rührung,
die einem ergriff, wenn am 1. August die bengalische Sonne im Garten
rotierte und man todesmutig die Vulkane und Raketen hochgehen liess,
genügten nicht mehr. Von 1974-79 war ich für das Militär tätig,
bis für mich der Widerspruch zwischen dem
technischen Fortschritt
und dem
menschlich organisatorischen Rückschritt in
billige Gruppenemotionen und virtuelle Schönreden
nicht mehr tragbar war und ich mich 1979 selbständig machte - was
zur Begründung von Applied Personal Science APS®
und damit zu dieser Site geführt hat... |
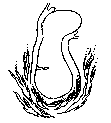 |
Im
globalen Wandel (1981-88):
Irgendwann
hat also das Gefühl für dieses Land für die meisten Schweizer ein
Knacks bekommen. Der Stolz ist brüchig geworden, und in den
Glauben haben sich berechtige
und eingebildete Zweifel eingeschlichen. |
| Es
war der Historiker Marcel
Beck an der Uni Zürich gewesen, der als erster die Rütli-Geschichte
in Frage stellte und uns beibrachte, dass das mit dem Wilhelm
Tell ins Reich der Mythen
und Legenden gehörte. Der
Bildersturm hat damals den Intellektuelle Spass gemacht und
ihre wahren Absichten offenbart; den
Postmodernism als Voraussetzung zur Globalisierung einzuführen.
Wir haben zu später realisiert, dass wir damit auch ein Stück
nicht nur unserer vermeintlichen, sondern unserer echten
Identität verloren. So
hat u.a. Max
Frisch uns mit «Andorra» der schöne Gewissheit beraubte, hier
bei uns hätte sich nie ereignen können, was drüben in Deutschland
geschah. Der Schock, der uns diese Einsicht damals versetzte,
wirkt bis heute nach und ist durch die
uns von aussen nochmals aufgezwungene Bewältigung der
Vergangenheit, mit der sich kaum jemand identifizierte, nur noch
verstärkt worden. Damit wurde in Wirklichkeit der Boden für eine
neues politisches Machspiel
und die wirtschaftliche Öffnung der Schweiz für die
Globalisierung vorbereitet.
Dieser,
für mich als Fehlentwicklung empfundene Neuausrichtung
versuchte ich mich 1986/87 vergeblich im Exil in Australien
zu entziehen. Dafür bracht ich meine Frau Diane aus Australien mit
zurück. Sie hat seither massgebend die Ausrichtung meiner
Forschungsarbeiten mit Wissenschaft#3
(auf Englisch) bestimmt... |
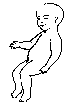 |
Egoistenland
(1988-95):
Indem man uns eine Schweiz vor Augen führte, die dem Ungeist
der Zeit nicht nur heldenhaft widerstand, sondern sich auch
geflissentlich aus allem herausgehalten und zum Teil sogar recht
bereitwillig mit der |
| neuen
Ideologie sympathisiert hat, war für das Volk dem Individualismus,
für die Intellektuellen der post-normalen Beliebigkeit Tür
und Tor geöffnet. Demoskopische
Untersuchungen belegen diesen dramatischen Wertwandel.
Mit
einer
Schweiz, die sich am Vermögen
der Verfolgten bereicherte, die Flüchtlinge an
ihren Grenzen in den Tod schickte und sich den Feind weniger
durch Tapferkeit als vielmehr durch geschicktes
Lavieren vom Hals hielt, und Leute wie Paul Grüninger
mobbte und Christoph Meili ins Exil zwang, kann man sich nicht
identifizieren.
Dazu
schrieb Klara
Obermüller
am 1. August 2001 in der Weltwoche: "Dass die gleiche
Neutralität, auf die man sich damals berief, später dazu herhalten
musste, sich internationalen
Verpflichtungen zu entziehen und gleichwohl in
einseitiger Parteinahme alles zu observieren, was sich irgendwie
links gebärdete, hat viel zu jenem Unmut beigetragen, der sich 1991
im teilweisen Boykott
der 700-Jahr-Feierlichkeiten entlud. «700
Jahre sind genug» war ein flapsiger Spruch. Jetzt sagt
man, er sei nicht so gemeint gewesen, wie er 1991 tönte. Er galt
nicht dem Land als solchem; er
gilt jetzt dem Bild, das dieses Land sich von sich selber
macht. Er kam von Seiten derer, die seit dem Krieg Schritt für
Schritt durch eine Schule
der Desillusionierung und Entmythologisierung
hindurchgegangen waren, und richtete sich gegen jene, die sich unter
Berufung auf den «Sonderfall Schweiz» jedem politischen
Wandel und jeder kritischen Selbstwahrnehmung
widersetzten."
Er
war, gemäss Moriz Leuenberger’s 1. Augustrede 2001 nicht Ausdruck
fehlender Liebe zur Schweiz; aber er enthielt das Eingeständnis,
dass diese Liebe schwierig geworden war. Schwierig, weil sie
neben dem Stolz auf das Geleistete auch das Bewusstsein
von Unterlassung und Schuld enthielt. Damit aber war dies
postnormale Mentalität der meisten Schweizer überfordert, und man
beliess es daher der Bergier-Kommission. Doch bei der
Abstimmung über die Verwendung des gehorteten Goldes, wie dieses Skelett
wieder aus dem Schrank geholt; die SVP und andere werden
damit ihr Süppchen zu kochen wissen. Schon meint die SVP die zeit
sie reif für die Abschaffung der Millizarmee...
1991
versuchte ich u.a. anlässlich der Zukunftsmesse in Lugano mit der
Präsentation eines Interaktiven Strategie Bearbeitungssystem,
ISB, eine Alternative zu diesem Niedergang aufzuzeigen. Ich
erinnere mich noch an die Weissweinfahne des inzwischen verstobenen
Bundesrat Delamuraz - da begann auch für mich der Fisch ganz oben
am Kopf zu stinken... |
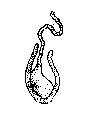 |
Hedonistenland
Schweiz
(1995-2002):
Jetzt treffen Blocher und Ebner et.al. die Saiten des Zeitgeistes in
diesem land und wieder fliesst Geld und vorerst noch verdeckt, Blut.
Mit
der Globalisierung wird zunehmend
|
| schwieriger,
sich noch länger
auf ein Anders- und Bessersein berufen zu können.
Zudem
werden immer mehr Ikonen des Schweizer Stolzes wie
Feldschlösschen, Sulzer etc. kannibalisiert und sogar die ABB,
schon lange nicht mehr schweizerisch, muss Federn lassen.
Dafür
expandieren die virtuellen aus Zürich, die UBS, Swiss Life,
Zürich etc.
Wer weiss, vielleicht wir "Rey" als Mythos dereinst
Willhelm Tell ablösen... |
So
bleibt uns nach Klara Obermüller: "...ein
Land, das Probleme hat, mit sich und den andern, ein
Land, das Mühe hat, sich auf die Erfordernisse einer veränderten
Zeit einzustellen, ein
Land wie alle andern auch.
Die Einsicht, dass der Schweiz in der Welt keine
Sonderstellung
zukommt, hat unser Selbstbewusstsein nicht weniger erschüttert als die
Erkenntnis, dass uns im Zweiten Weltkrieg das
Heldentum, wie Dürrenmatt einmal sagte, nur erspart geblieben ist, weil
Tell den Gesslerhut halt doch ein klein wenig grüsste.
Doch damit müssen wir leben, und es wäre eine Illusion und keine Liebe,
wenn wir über das Prekäre dieser Situation einfach hinwegsehen wollten. «Die
Lage, in der sich die Schweiz heute befindet, ist so komplex
und neuartig, dass man sich nicht einfach auf das Alt-Gute berufen und zum
bewährten Nein gegenüber dem Neuen greifen kann. Wir dürfen uns von der nächsten
Generation nicht beschuldigen lassen, wir hätten die Zeichen
der Zeit nicht zu lesen gewusst, weil wir auf das Phänomen der
schweizerischen Unabhängigkeit gestarrt und die Überzeugung vom Sonderfall
Schweiz wie ein Brett
vor dem Kopf gehabt hätten», so hat Karl Schmid bereits 1968 in
einem Vortrag gesagt und vor der Gefahr einer Seelenruhe
gewarnt, «die sich keine
Alternativen mehr vorstellen kann und will»
Ich meine diese intellektuelle Einschätzung, so gut sie auch tönt, ist
nicht nur zu billig, sie führt in die Irre der Sinn- und
Orientierungslosigkeit. Sie ist ein typsicher Pre-Trans-Trap
Verrat an unseren Wurzeln zugunsten der sich schon
längst ad absurdum geführten Anmassung der
Wissenschaft#2!
Um sich für den darüber hinausführenden Rechtzeitig
Projekt-Orientierten Kompetenzaustausch, RPOK©
zu qualifizieren, sind SIE auf die Lektionen
1-12 verwiesen.
L2) §GHL-Geradlinigkeit
Organisation
Schweiz: 700 Jahre sind nicht genug!

> Bitte senden Sie Ihr FEEDBACK an Dr. Peter Meier Version
27.03.08
|